FAQ für Verbraucherinnen und Verbraucher
Inhalt
Allgemeines zum Pkw-Label
Die Einführung des Pkw-Labels (Hinweis) geht auf die EU-Richtlinie 1999/94/EG vom 13. Dezember 1999 über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen beim Marketing für neue Personenkraftwagen zurück. Sie schreibt vor, dass alle neuen Pkw, die in den EU-Mitgliedstaaten zum Verkauf oder zum Leasing angeboten werden, mit Informationen über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen versehen werden müssen.
Damit wurde ein Instrument geschaffen, das Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen soll, bei der Entscheidung über den Kauf eines neuen Pkw auch den spezifischen Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten zu berücksichtigen und einen Vergleich zwischen alternativen Neuwagenmodellen zu erleichtern. Neben Informationen zu Marke, Handelsbezeichnung, Antriebsart und Kraftstoff bzw. Energieträger enthält das Pkw-Label auch Angaben zu Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Energiekosten, möglichen CO2-Kosten und zu der CO2-Klasse des ausgestellten oder beworbenen Pkw. Außerdem enthält das Pkw-Label Angaben zur Höhe der aktuellen, jährlich zu entrichtenden Kfz-Steuer.
Das Pkw-Label (Hinweis) ist mit der Verordnung über Verbraucherinformationen zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen (Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung - Pkw-EnVKV) zum 1. Dezember 2011 durch den Gesetzgeber eingeführt worden.
Die zuletzt überarbeitete Fassung der Pkw-EnVKV ist am 23. Februar 2024 in Kraft getreten. Mit dieser Änderung wurden die Umstellung auf die mit dem realitätsnäheren WLTP-Messverfahren ermittelten Verbrauchs- und Emissionswerte sowie weitere Informationen und Verbesserungen des Pkw-Labels eingeführt.
Seit dem 1. September 2018 müssen für alle in der Europäischen Union (EU) erstmals zugelassenen neuen Pkw die Emissions- und Verbrauchswerte auf Basis des WLTP-Messverfahrens erhoben werden. Seit der Überarbeitung der Pkw-EnVKV sind diese WLTP-Messwerte auch im Pkw-Label (Hinweis) aufzunehmen.
Zusätzlich unterscheidet sich das Pkw-Label seit dem je nach Antriebsart und dem Kraftstoff bzw. Energieträger des Pkw. Für reine Elektrofahrzeuge (BEV), für Brennstoffzellenfahrzeuge und für Plug-in-Hybride werden zusätzliche Informationen angegeben (z. B. die elektrische Reichweite und der Stromverbrauch).
Damit werden für Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Einzelinformationen zu den jeweiligen neuen Pkw zur Verfügung gestellt und Unterschiede der verschiedenen Antriebsarten transparenter und anschaulicher aufgezeigt.
Im oberen Bereich des DIN-A-4-großen Pkw-Labels (Hinweis) sind Angaben zur Marke, Handelsbezeichnung, Antriebsart und zum Kraftstoff und – je nach Antriebsart – weiteren Energieträgern zu finden. In diesem Bereich sind sowohl die Informationen zum spezifischen Energieverbrauch - in Liter (l), Kilogramm (kg) oder Kilowattstunde (kWh) je 100 Kilometer - angegeben, als auch die spezifischen CO2-Emissionen in Gramm je Kilometer.
Im Zentrum des Pkw-Labels steht die farbige CO2-Klassenskala. Die Farbskala erinnert an die bei Haushaltsgeräten (wie z. B. Kühlschränken) geläufige Form der Energieeffizienzkennzeichnung. Jeder neue Pkw wird einer CO2-Klasse zugeordnet. Dabei steht etwa die rot markierte Klasse „G“ für Autos mit besonders hohem CO2-Ausstoß und die grüne Klasse „B“ für besonders CO2-arme Fahrzeuge. Der CO2-Klasse „A“ werden neue Pkw zugeordnet, die keine CO2-Emissionen ausstoßen.
Unterhalb der farbigen CO2-Klassenskala sind Informationen zu den Energiekosten bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometer sowie zu möglichen CO2-Kosten über zehn Jahre angegeben.
Weiterhin sind Informationen zur Höhe der aktuellen Kraftfahrzeugsteuer pro Jahr ausgewiesen. Im unteren Bereich des Labels finden sich Hinweise zu den Informationen in Textform sowie Angaben zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) und dem Ausstellungsdatum des Labels.
Ein Beispiel für ein Pkw-Label finden Sie hier.
Ja, das Pkw-Label (Hinweis) ist verpflichtend für alle neuen Pkw, die zum Verkauf, Leasing oder zur Langzeitmiete angeboten werden – sowohl im Autohaus als auch online bei der Fahrzeugkonfiguration. Das Pkw-Label muss gut sichtbar am Fahrzeug selbst oder auf einem Aufsteller in dessen Nähe angebracht sein. Bei Online-Angeboten muss es zumindest als grafische Darstellung angezeigt werden.
Ein Verstoß gegen die Vorgaben – etwa wenn Händler kein Pkw-Label ausstellen oder ein veraltetes verwenden – stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.
Gebrauchtwagen können gemäß der novellierten Pkw-EnVKV unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben ebenfalls mit dem Pkw-Label gekennzeichnet werden – dies ist jedoch freiwillig.
Nein, die Nutzung eines QR-Codes oder einer Verlinkung auf eine andere Website ist derzeit aus rechtlichen Gründen nicht möglich.
Nein, die Kennzeichnungspflicht mit dem Pkw-Label (Hinweis) gilt nur für neue Pkw. Gebrauchtwagen können jedoch unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben freiwillig mit dem Pkw-Label gekennzeichnet werden.
CO2-Klasse
Die Einteilung der Pkw-Neuwagenmodelle in CO2-Klassen wird beim neuen Pkw-Label (Hinweis) nur noch anhand der absoluten CO2-Emissionswerte (in Gramm je Kilometer) vorgenommen. Das Fahrzeuggewicht wird nicht mehr berücksichtigt.
Diese neue CO2-Klasseneinteilung ersetzt die in der Vergangenheit genutzte relative Skala (CO2-Effizienzklassen), die das Gewicht des Fahrzeugs einbezog. Durch die neue Klasseneinteilung wird verhindert, dass besonders große und schwere Pkw aufgrund ihres Gewichts in eine bessere CO2-Klasse eingeordnet werden können als deutlich leichtere Fahrzeuge mit gleich hohen Emissionen.
Welcher CO2-Klasse ein Auto zugeordnet wird, ist abhängig vom spezifischen CO2-Ausstoß in Gramm je Kilometer. Maßgeblich dafür sind die auf Basis des EU-weit maßgeblichen WLTP-Messverfahrens festgestellten absoluten CO2-Emissionswerte. In der Pkw-EnVKV werden insgesamt sieben CO2-Klassen festgelegt. Die neue Farbskala reicht von „A“ (CO2-emissionsfreie Fahrzeuge) bis „G“ (Fahrzeuge mit den höchsten CO2-Emissionen). Sie gibt übersichtlich und leicht verständlich Auskunft darüber, wie viele CO2-Emissionen der neue Pkw je gefahrenem Kilometer (in g CO2/km) ausstößt.
Der schwarze Pfeil auf dem Pkw-Label (Hinweis) zeigt an, welcher CO2-Klasse der neue Pkw zugeordnet wird. Verbraucherinnen und Verbraucher können somit auf einen Blick erkennen, wie hoch die spezifischen CO2-Emissionen ihres Fahrzeugs im Vergleich zu anderen Modellen ausfällt.
Pkw, die ausschließlich mit einem Elektromotor angetrieben werden (rein batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellenfahrzeuge), sind auf dem Pkw-Label (Hinweis) der CO2-Klasse „A“ zuzuordnen, da sie im Betrieb keine CO2-Emissionen ausstoßen. CO2-Emissionen, die durch die Herstellung des Fahrzeugs und der Kraftstoffe bzw. der Stromerzeugung entstehen, werden bei der Messung der CO2-Emissionen am Auspuff nicht berücksichtigt (sog. Tank-to-Wheel-Betrachtung).
Bei einem Plug-in-Hybrid (PHEV) handelt es sich um ein Fahrzeug mit einem kombinierten Antrieb, also mit einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor. Aus diesem Grund sieht die neue Pkw-EnVKV für PHEV-Modelle erstmals eine doppelte Kennzeichnung vor (zwei Pfeile in der Farbskala auf dem Pkw-Label). Der erste Pfeil gibt wie bisher die Klasseneinstufung nach dem gewichtet kombinierten Wert an, dem offiziellen Durchschnittswert der CO2-Emissionen im Mischbetrieb von Elektromotor und Verbrennungsmotor. Der zusätzliche zweite Pfeil gibt die CO2-Klasse beim reinen Verbrenner-Betrieb mit entladener Batterie an.
Diese zusätzliche Information ist für Verbraucherinnen und Verbraucher wichtig, um die Energieeffizienz des Pkw auch bei entladener Batterie einschätzen zu können.
Energie- und CO₂-Kosten
Die Kosten der CO2-Bepreisung sind in den Tankstellenpreisen für fossile Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, CNG und LPG enthalten. Um die Klimaziele zu erreichen, soll der CO2-Preis mit der Zeit steigen, wodurch künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten zu erwarten sind. Mit einer steigenden CO2-Bepreisung fossiler Kraftstoffe soll auch ein Anreiz geschaffen werden, auf klimafreundliche bzw. emissionsarme Fahrzeuge umzusteigen. Um Unsicherheiten bei der CO2-Preisentwicklung zu berücksichtigen, werden im Pkw-Label (Hinweis) drei mögliche angenommene CO2-Preisszenarien („niedrig“, „mittel“ und „hoch“) angenommen. Die möglichen CO2-Kosten werden analog zu den Energiekosten über einen Zeitraum von zehn Jahren mit einem Richtwert von 15.000 Kilometer Jahresfahrleistung auf dem Label berechnet.
Die Bepreisung des CO2-Ausstoßes wurde von der Bundesregierung im Jahr 2021 mit der Einführung des nationalen Brennstoffemissionshandelssystems unter anderem auf den Verkehrssektor ausgeweitet. Damit wird ein Preis auf CO2-Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Erdgas angesetzt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher entrichten diesen Kostenbeitrag unmittelbar beim Tanken.
Durch die CO2-Bepreisung können sich die Kraftstoffkosten im Zeitverlauf erhöhen. Damit soll auch ein Anreiz geschaffen werden, auf klimafreundliche bzw. emissionsarme Fahrzeuge umzusteigen. Die Entwicklung des CO2-Preises ist derzeit gesetzlich durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) festgelegt. Ab dem Jahr 2027 wird der CO2-Preis für Kraftstoffemissionen als Teil des europäischen Emissionshandelssystems (ETS-2) auf dem Markt für Emissionszertifikate gebildet.
Die durchschnittliche Jahresfahrleistung in Deutschland ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück und lag nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) im Jahr 2024 bei 12.309 Kilometern je Pkw. Durch die geringere angenommene Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometer werden Verbraucherinnen und Verbrauchern realitätsnähere Informationen über die im Durchschnitt zu erwartenden Kraftstoff- bzw. Energiekosten des Wunschfahrzeugs gegeben. Im Pkw-Kostenrechner können Sie die Jahresfahrleistung individuell eingeben, um präzisere Berechnungen zu erhalten.
Auf dem Pkw-Label (Hinweis) sind Informationen zu den Energiekosten zu finden, die einen Anhaltspunkt über die Tank- bzw. Ladekosten auf Grundlage von Durchschnittspreisen aus dem vorherigen Jahr bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometer darstellen. Die Energiekosten werden auf Basis des kombinierten Energieverbrauchs je 100 Kilometer, den durchschnittlichen Tankstellenpreisen des jeweils zutreffenden Energieträgers und der Jahresfahrleistung von 15.000 km berechnet. Die für die Berechnung der Energiekosten verwendeten Preise basieren dabei auf der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie jährlich zum 30. Juni veröffentlichten Kraftstoffpreisliste. Die tatsächlichen Energiekosten für Verbraucherinnen und Verbraucher können von den auf dem Pkw-Label angegebenen Energiekosten abweichen, wenn der Energieverbrauch im Realbetrieb auf der Straße, die individuelle Jahresfahrleistung oder die Kraftstoffpreise von den Annahmen im Pkw-Label abweichen.
Fragen und Antworten zum Thema WLTP
Das WLTP-Messverfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) ist ein europaweit standardisierte Prüf- und Messverfahren zur Ermittlung des Strom- und Kraftstoffverbrauchs, der CO2-Emissionen und anderer Werte von Fahrzeugen. Durch das standardisierte Prüfverfahren wird eine verlässliche und nach einheitlichen Methoden vollzogene Ermittlung von Verbrauchs- und Emissionswerten sichergestellt. Die unter klar definierten Laborbedingungen reproduzierbaren Ergebnisse durch das WLTP-Messverfahren sind auch notwendig, um die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten bei der Typgenehmigung neuer Fahrzeuge zu prüfen. Die WLTP-geprüften offiziellen CO2-Emissionswerte dienen zudem als Bemessungsgrundlage für die Kfz-Steuer.
Seit dem 1. September 2018 müssen für alle in den EU-Mitgliedstaaten neu zugelassenen Pkw nach dem WLTP-Messverfahren gemessene Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity – CoC) angegeben werden.
Im Jahr 1992 wurde das NEFZ-Messverfahren (Neuer Europäischer Fahrzyklus) eingeführt. Seit dem 1. September 2017 ist die Angabe von Emissions- und Verbrauchswerten, die im WLTP-Messverfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) ermittelt wurden, die verpflichtende Grundlage für die Erteilung einer Typgenehmigung neuer Pkw. Damit löste das WLTP-Messverfahren das bis dahin geltende NEFZ-Messverfahren ab.
Ein Anlass für den Wechsel war die Feststellung, dass die anhand von vorgegebenen Fahrzyklen im Labor gemessenen Verbräuche zu stark von den im realen Betrieb auf der Straße beobachteten Kraftstoffverbräuche abwichen. Ursächlich dafür war unter anderem, dass der NEFZ-Fahrzyklus, der Anfang der 90er Jahre verpflichtend eingeführt wurde, nicht mehr den heute gängigen Fahrstilen, insbesondere den üblichen Beschleunigungen und Regelgeschwindigkeiten, entspricht. Hinzu kommt, dass Testbedingungen nicht mit der heute allgemein üblichen Fahrzeugausstattung übereinstimmen. So werden zum Beispiel Zusatzausstattungen wie Radio, Klimaanlage oder Sitzheizung in den Testfahrzeugen nicht verbaut beziehungsweise dürfen beim Messbetrieb ausgeschaltet werden. Dadurch ergibt sich ein geringeres Gewicht und ein niedrigerer Energieverbrauch und dementsprechend zu starke Abweichungen der Messergebnisse von den realen Emissions- und Verbrauchswerten.
Nein. Die Umstellung von NEFZ zu WLTP wirkt sich nicht auf alle Fahrzeuge in gleicher Weise aus. Analysen haben ergeben, dass der Unterschied zwischen NEFZ und WLTP bei kleineren Fahrzeugen höher ausfällt als bei größeren Fahrzeugen. Auch ist der Unterschied beim Kraftstoffverbrauch von vergleichbaren Benzinern tendenziell größer als bei Diesel-Fahrzeugen. Dies liegt unter anderem an den vorgegebenen Schaltpunkten, der höheren Fahrdynamik sowie den durchschnittlich höheren Geschwindigkeiten beim WLTP-Messverfahren.
Um realitätsnähere Messergebnisse zu erzielen, hat die United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) das WLTP-Messverfahren entwickelt. Dieses fällt im Vergleich zum NEFZ-Messverfahren deutlich dynamischer aus: Die Prüfzeit wurde auf 30 Minuten erhöht und ist damit 10 Minuten länger als beim NEFZ-Messverfahren. Die auf dem Prüfstand gefahrene Strecke beträgt nun etwa 23 Kilometer und ist somit 12 Kilometer länger als beim NEFZ-Messverfahren. Zudem wird schneller gefahren. Die mittlere Geschwindigkeit beträgt zirka 47 km/h, die Höchstgeschwindigkeit 131 km/h und auch stärkere Beschleunigungsvorgänge werden berücksichtigt. Neben dem Fahrzyklus selbst haben sich aber auch die Prüfbedingungen verschärft. Die Tests müssen nun an vollausgestatteten Fahrzeugen stattfinden, sodass zusätzliches Gewicht und ein dadurch höherer Energieverbrauch berücksichtigt werden. Zudem gibt es eine vom UN-Gremium festgelegte Prüftemperatur von 23 Grad Celsius. Diese wird in Europa um einen Zusatztest bei 14 Grad Celsius ergänzt, um die örtliche Durchschnittstemperatur mit abzubilden. Zuvor wurden die Tests bei 20 bis 30 Grad Celsius durchgeführt. Bei einer höheren Außentemperatur erreicht der Motor schneller seine Betriebstemperatur und verbraucht entsprechend weniger.
Den einen Realverbrauch gibt es nicht. Der betriebsbedingte Strom- und Kraftstoffverbrauch und somit auch die Emissionen von Pkw werden stark vom individuellen Fahrstil, dem Verkehrsfluss, den topografischen Eigenschaften der Fahrumgebung und den Witterungsverhältnissen beeinflusst. Laut ADAC kann allein der Fahrstil zu einem Mehrverbrauch von 20 Prozent führen. Die WLTP-Messwerte werden somit nicht identisch mit den tatsächlichen Verbräuchen auf der Straße sein. Aber die WLTP-Messwerte dürften deutlich näher an den tatsächlichen Verbräuchen im Realbetrieb liegen, als es noch beim alten NEFZ-Verfahren der Fall war. Die Messung auf dem Prüfstand unter Laborbedingungen bleibt dennoch wichtig, um die verschiedenen Fahrzeuge der unterschiedlichen Hersteller unter gleichen Bedingungen zu testen und vergleichbare, wiederholbare Ergebnisse zu ermitteln. Gerade die Wiederholbarkeit unter standardisierten Testbedingungen ist von großer Bedeutung für die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlich festgelegten Emissionsgrenzwerte und zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen hinsichtlich versprochener Fahrzeugeigenschaften.
Die WLTP-Tests können auf zertifizierten Prüfständen bei den Automobilherstellern oder auf Prüfständen von herstellerunabhängigen technischen Prüforganisationen (TÜV, Dekra) durchgeführt werden. Wenn die Hersteller sich für eine Durchführung der Tests auf eigenen Prüfständen entscheiden, müssen diese im Beisein eines zugelassenen Technischen Dienstes stattfinden. Die technischen Prüforganisationen sind von der jeweiligen Aufsichtsbehörde zugelassen. In diesem Fall ist die zulässige Aufsichtsbehörde das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Das KBA betreibt auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände in Leck in Schleswig-Holstein seit 2020 ein eigenes Testgelände, auf dem im Rahmen der Marktüberwachung unangemeldete Tests von direkt aus der Produktion entnommenen Fahrzeugen stattfinden.
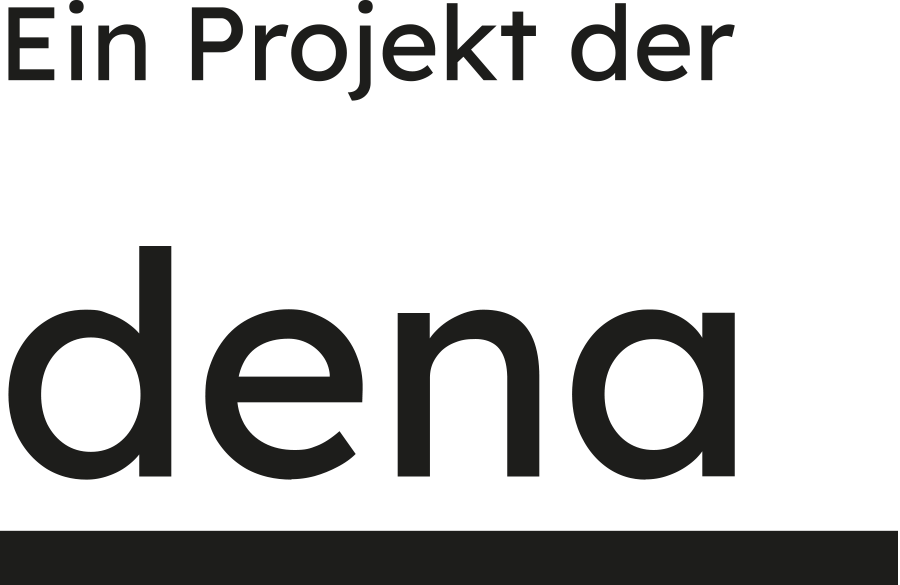
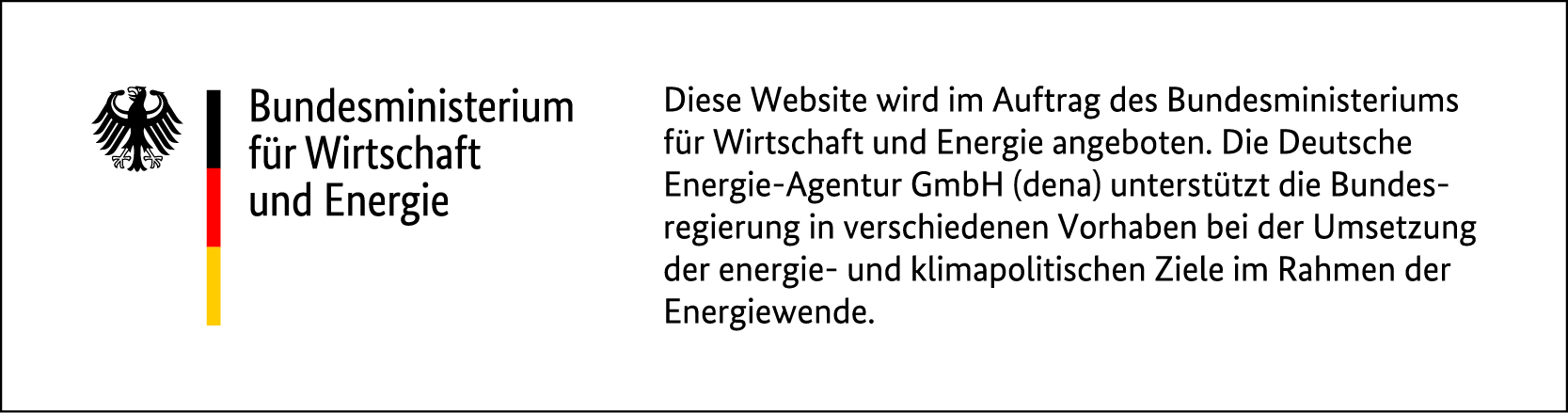
Rechtlicher Hinweis
Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informiert im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dieser Informationsplattform zur Verkehrs- und Mobilitätswende. Darüber hinaus erhalten Hersteller und Händler Informationen zur Umsetzung der novellierten Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Dabei handelt es sich um allgemeine Hinweise, die nicht rechtsverbindlich sind. Für konkrete Fragen ist ggf. eine Rechtsberatung einzuholen. Die dena übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der mittels des Online-Tools zur Erstellung eines Pkw-Labels berechneten Ergebnisse. Entscheidend sind u. a. die Herstellerangaben.