Monitoringbericht 2024: Neuzulassungen von Pkw mit elektrischen Antrieben

Zusammenfassung
Der dena-Monitoringbericht bietet einen Einblick in die Entwicklung der Neuzulassungszahlen von Pkw in Deutschland, mit Fokus auf rein batterieelektrisch betriebene Pkw (BEV) sowie Plug-in-Hybride (PHEV). Im Jahr 2024 wurden insgesamt 2.817.331 Pkw neu zugelassen, etwas weniger als im Jahr zuvor (–1 Prozent). Darunter waren 380.609 BEV (14 Prozent) sowie 191.905 PHEV-Pkw (7 Prozent).
Die Zahl der batterieelektrischen Pkw-Neuzulassungen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen (–27 Prozent). Bei der Neuzulassung von Plug-in-Hybriden konnten hingegen leichte Zuwächse verzeichnet werden (+9 Prozent). Der BEV-Gesamtbestand in Deutschland wuchs auf rund 1,79 Millionen. Dies entspricht einem Anteil von 3,6 Prozent aller zugelassenen Pkw.
Der Rückgang bei den Neuzulassungen batterieelektrischer Pkw ist hauptsächlich auf die Kaufzurückhaltung der privaten Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzuführen, welche im Vergleich zum Vorjahr 39 Prozent weniger BEV nachgefragt haben. Die Zahl der Neuzulassungen von BEV durch gewerbliche Halterinnen und Halter hat sich um 19 Prozent verringert. Dabei setzte sich der Trend zu größeren und hochpreisigen Elektroautos fort. Im Jahr 2024 entschieden sich sowohl gewerbliche als auch private Halterinnen und Halter neben der Kompaktklasse insbesondere für Elektro-SUV sowie Elektro-Pkw der oberen Mittelklasse.
Die Top-BEV-Hersteller waren wie auch im Vorjahr Volkswagen, BMW, Tesla und Mercedes. Škoda konnte einen deutlichen Zuwachs verzeichnen und löste Audi unter den Top 5-Herstellern mit den meisten BEV-Neuzulassungen ab. Auch wenn das Tesla Model Y wie bereits im Vorjahr auf dem Spitzenplatz der neu zugelassenen BEV-Modelle lag, stürzte die Zahl der Neuzulassungen von Tesla in Deutschland insgesamt um 41 Prozent ab. Bei den Top-Modellen der Plug-in-Hybride lag im Jahr 2024 der Volvo XC60 an der Spitze.
Mit Blick auf die regionale Verteilung wiesen die Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein mit jeweils rund 16 Prozent den höchsten Anteil an batterieelektrischen Neuzulassungen auf. In den meisten ostdeutschen Bundesländern lag der prozentuale Anteil nur etwa halb so hoch. Insgesamt haben die Hansestadt Hamburg (4,8 Prozent) und das Land Hessen (4,3 Prozent) die höchsten Anteile von BEV im Pkw-Gesamtbestand, knapp gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.
Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland ist im Jahr 2024 weiter vorangekommen und insbesondere die Zahl der Schnellladepunkte ist stark angestiegen (+39 Prozent). Der Anteil der Schnellladepunkte mit mehr als 22 kW lag am 1. Dezember 2024 bei 22 Prozent. Bezogen auf die Dichte der öffentlichen Ladeinfrastruktur pro Quadratkilometer ist die Ladesäulendichte der Schnell- und Normalladepunkte in Berlin, Hamburg und Bremen am höchsten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Gemessen an der Einwohnerzahl liegen Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein vorne.
Mit dem Rückgang der BEV-Neuzulassungen ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß der neuzugelassenen Pkw angestiegen (+4,2 Prozent). Dies stellt die Autohersteller insbesondere vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Grenzwerte im Jahr 2025 vor Herausforderungen. Zur Einhaltung der CO2-Flottenzielwerte der EU sowie zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung braucht es in den nächsten Jahren einen deutlich stärkeren Zuwachs der Elektromobilität in Deutschland.
Pkw-Neuzulassungen: Einbruch bei Neuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge
Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 2.817.331 Pkw neu zugelassen. Damit liegt die Zahl der neu zugelassenen Pkw knapp unter der vom Vorjahr (–1 Prozent), aber weiter deutlich unterhalb des Niveaus aus der Vor-Corona-Zeit (2019: 3.607.258 Pkw-Neuzulassungen).
Batterieelektrische Pkw (BEV): Die Zulassung von batterieelektrischen Pkw ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr von rund einer halben Million auf 380.609 deutlich zurückgegangen (–27 Prozent). Der Anteil der BEV an den neu zugelassenen Pkw insgesamt sank damit von 18 Prozent (2023) auf 14 Prozent im Jahr 2024. Der Gesamtbestand an batterieelektrischen Pkw in Deutschland wuchs auf rund 1,79 Millionen. Dies entspricht einem BEV-Anteil von 3,6 Prozent aller zugelassenen Pkw.
Plug-in-Hybride (PHEV): Bei den Neuzulassungen von Pkw mit Plug-in-Hybrid-Antrieb konnte im Jahr 2024 ein leichter Zuwachs verzeichnet werden. Die Zahl der PHEV-Fahrzeuge stieg von 175.724 im Jahr 2023 auf 191.905 im Jahr 2024 (+9 Prozent). Der Anteil von PHEV an den Gesamtzulassungen ist mit 7 Prozent jedoch immer noch vergleichsweise gering.

Hybride (ohne Plug-in-Hybride): Insgesamt hat die Zahl der Neuzulassung von Hybrid-Pkw (Voll- und Mildhybride) im Jahr 2024 in Deutschland zugenommen. Die Zahl der Neuzulassungen von nicht extern aufladbaren Mild- und Vollhybrid-Pkw, in denen ein Verbrennungsmotor (mehrheitlich Benzinmotor) mit einem oder mehreren Elektromotoren verbunden wird, ist um 14 Prozent auf 755.493 angestiegen. Damit haben die Hybride einen Anteil von 27 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen insgesamt und liegen leicht über dem kombinierten Anteil von BEV und PHEV.
Brennstoffzellen Pkw (FCEV): Pkw mit Brennstoffzellen-Antrieben spielen auf dem Neuwagenmarkt mit insgesamt 158 neu zugelassenen Pkw und einem deutlichen Rückgang der Zulassungszahlen (–40 Prozent) kaum eine Rolle.
Benzin- und Diesel-Pkw: Die Zahl der Neuzulassungen reiner Benzin- und Diesel-Pkw bewegt sich im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlichen Niveau. Insgesamt wurden 991.948 Pkw mit Benzinmotor neu zugelassen (+1,4 Prozent), was einem Anteil von 35 Prozent aller Neuzulassungen entspricht. Diesel-Pkw haben mit 483.261 Fahrzeugen (–0,7 Prozent) einen Anteil von rund 17 Prozent an allen Neuzulassungen.
Die Entwicklung der Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2024 ist demnach von einem deutlichen Rückgang der vollelektrischen und einem deutlichen Zuwachs der Neuzulassungen von Hybrid-Pkw (insbesondere Vollhybriden) geprägt. Die Zulassungszahlen klassischer Diesel- und Benzinantriebe blieben konstant.
Ein Grund für den deutlichen Rückgang der Neuzulassungen batterieelektrischer Pkw liegt vermutlich in dem plötzlichen Wegfall des Umweltbonus im Dezember 2023. Die allgemeine wirtschaftliche Krisenstimmung, Unklarheit über die zukünftigen politischen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Energiepreise haben ebenfalls zur Zurückhaltung beim Neukauf batterieelektrischer Pkw in Deutschland beigetragen. Zudem haben die öffentlichen Debatten über die europäische CO2-Regulierung und um das „Verbrenner-Aus“ mutmaßlich ebenso zu einer Verunsicherung in Bezug auf den Neukauf batterieelektrischer Fahrzeuge geführt. Verbraucherinnen und Verbraucher warten aktuell erst einmal ab, ob sich der Trend hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen wirklich langfristig durchsetzt. Die Aussicht auf zukünftig günstiger werdende BEV-Modelle könnte ebenfalls dazu geführt haben, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf eines E-Autos zunächst abwarten, um möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt günstigere Modelle bzw. Modelle mit leistungsstärkeren Batterien zu erwerben.
Halterinnen und Halter von Elektroautos: Insbesondere die Zahl der Plug-in-Hybrid-Dienstwagen steigt
Der Rückgang bei den Neuzulassungen vollelektrischer Pkw ist hauptsächlich auf die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher zurückzuführen, welche im Vergleich zum Vorjahr 39 Prozent weniger BEV nachgefragt haben. Bei den gewerblichen Halterinnen und Haltern hat sich die Anzahl um 19 Prozent verringert (siehe Abbildung 2). Damit dominieren weiterhin gewerbliche Halterinnen und Halter den E-Auto-Markt.

Während Privatpersonen durch den Wegfall des Umweltbonus ein zentrales Anreizinstrument für den Kauf neuer batterieelektrischer Pkw verloren haben, blieben die Rahmenbedingungen für gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer im vergangenen Jahr weitgehend unverändert. Dies führte zu einem vergleichsweise geringeren Rückgang in diesem Segment.
Der Anteil von privaten und gewerblichen Kfz-Halterinnen und Haltern liegt bei batterieelektrischen Pkw auf einem ähnlichen Niveau wie bei allen Antriebsarten insgesamt: Rund ein Drittel der Halterinnen und Halter von BEV-Neuwagen sind Privatpersonen, etwa zwei Drittel bestehen aus gewerblichen Kundinnen und Kunden. Bei Plug-in-Hybriden machen hingegen die privaten Halterinnen und Halter weniger als ein Fünftel aller Neuzulassungen aus (18 Prozent), während 82 Prozent dem Gewerbe zuzuschreiben sind.
Elektroautos nach Segmenten: Ein Viertel der neuen SUV fährt vollelektrisch
Mit Blick auf die Fahrzeugklassen zeigt sich, dass sich im Jahr 2024 vor allem bei Pkw der oberen Mittelklasse, der Oberklasse und bei den SUV für einen Elektroantrieb entschieden wurde. Im nachfragestärksten Segment der SUV beträgt der Anteil von BEV knapp ein Viertel, ebenso wie bei Fahrzeugen der oberen Mittelklasse (23 und 28 Prozent, siehe Abbildung 3). Im zweitwichtigsten Fahrzeugsegment, der Kompaktklasse, beträgt der Anteil der batterieelektrischen Pkw bei den Neuzulassungen 11 Prozent.

Plug-in-Hybride haben ihre größten Anteile ebenfalls bei Fahrzeugen der oberen Mittelklasse (20 Prozent) und bei Geländewagen (18 Prozent).
Im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere der Anteil der Neuzulassungen von BEV in den Segmenten Minis und Kleinwagen deutlich zurückgegangen (–71 bzw. –57 Prozent), wobei der Anteil der Pkw im Mini-Segment in allen Antriebs- und Kraftstoffarten insgesamt stark abgenommen hat (–43 Prozent).
Der Trend zu größeren und teureren Pkw ist nicht nur auf die allgemeine Beliebtheit von SUV in Deutschland zurückzuführen, sondern zeigt sich bei Elektrofahrzeugen in besonders ausgeprägter Form. Dies lässt sich vermutlich auch durch das bislang noch begrenzte Angebot an günstigen BEV-Kleinwagen erklären, die aufgrund höherer Produktionskosten häufig deutlich teurer sind als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die höheren Entwicklungs- und Herstellungskosten können leichter in Fahrzeugen der oberen Mittelklasse oder im SUV-Segment integriert werden. Darüber hinaus verfügen Fahrzeuge der oberen Mittelklasse und SUV in der Regel über größere Batteriesysteme, die höhere Reichweiten ermöglichen – ein entscheidendes Kaufkriterium für viele Verbraucherinnen und Verbraucher.
Top-Seller: Škoda legt zu, Tesla stürzt ab
Mit Blick auf die neu zugelassenen batterieelektrischen Pkw gehören Volkswagen, BMW und Mercedes erneut zu den Top 5, ebenso wie der Elektroautohersteller Tesla. Volkswagen verteidigt trotz eines Rückgangs der Verkaufszahlen (–12 Prozent) seinen Spitzenplatz bei den neu zugelassenen BEV, gefolgt von BMW auf Platz 2, wo es leichte Zuwächse bei den Neuzulassungen batteriebetriebener Fahrzeuge gegeben hat (+4 Prozent). Der Automobilhersteller Škoda konnte ebenfalls Zuwächse verzeichnen (+8 Prozent) und ist nun auch in den Top 5 der meisten BEV-Neuzulassungen vertreten (siehe Abbildung 4). Die Neuzulassungen von Tesla gingen hingegen um 41 Prozent zurück. Der signifikante Rückgang bei Tesla im Vergleich zu allen anderen Marken ist vermutlich auf eine alternde Fahrzeugpalette zurückzuführen, während die deutschen Hersteller, die traditionell einen hohen Anteil am Binnenmarkt haben, mit einem breiteren Modellangebot an Elektrofahrzeugen aufgeholt haben.

Die Marke Volvo verzeichnete deutliche Zuwächse bei der Zahl der neu zugelassenen E-Pkw, vor allem im Bereich der Plug-in-Hybride, aber auch bei BEV (+59 Prozent). Der Automobilhersteller Audi hingegen hatte einen deutlich geringeren Anteil an neu zugelassenen vollelektrischen Pkw im Vergleich zum Vorjahr (–29 Prozent) und ist damit nicht mehr in den Top 5 vertreten. Chinesische Automarken wie BYD und GWM spielen mit jeweils rund 3.000 Pkw-Neuzulassungen eine untergeordnete Rolle auf dem BEV-Neuwagenmarkt in Deutschland. Insgesamt entfielen nur rund 1,5 Prozent der BEV-Neuzulassungen auf chinesische Modelle.
Bei den Top 3 der neu zugelassenen Pkw-Modelle landet Teslas Model Y bei den E-Autos wie bereits im Vorjahr auf dem Spitzenplatz, gefolgt vom Škoda ENYAQ, dem VW ID.3. Bei den Plug-in-Hybriden liegen der VOLVO XC60 an der Spitze, gefolgt von Mercedes mit der PHEV-E-Klasse und dem Mercedes GLK und GLC.
Mit Blick auf die Marken der neu zugelassenen Pkw aller Antriebsarten zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen. Die großen deutschen Automarken Volkswagen, Mercedes, BMW und Audi gehören auch weiterhin zu den Top 5 der meisten Pkw-Neuzulassungen. Im Vergleich zu 2023 konnte Škoda einen deutlichen Anstieg verzeichnen (+22 Prozent) und stieg somit auf Platz 4.
Elektroautos nach Regionen: Baden-Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein liegen vorn, ostdeutsche Bundesländer noch zurückhaltend
Bei der regionalen Verteilung haben Baden-Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein mit jeweils 16 Prozent die höchsten prozentualen Anteile an batterieelektrischen Pkw-Neuzulassungen (siehe Abbildung 5).
Sachsen (9 Prozent), Sachsen-Anhalt (8 Prozent), Thüringen (9 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (10 Prozent) zeigen die niedrigsten Werte, was auf eine langsamere Marktdurchdringung der Elektromobilität in Ostdeutschland hinweist. Dies könnte in der dort tendenziell weniger stark ausgebauten Ladeinfrastruktur (siehe Kapitel 6) sowie der geringeren Kaufkraft für vergleichsweise teure Elektroautos begründet sein.

Im Vergleich zum Jahr 2023 ging die Zahl der neu zugelassenen BEV vor allem in Hessen deutlich zurück (–40 Prozent), während in der Hansestadt Bremen der geringste Rückgang zu verzeichnen war (–19 Prozent).
Die Verteilung der Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden ergibt ein ähnliches Bild. Hier variieren die Anteile an den Neuzulassungen zwischen 4 Prozent in Thüringen und 10 Prozent in Baden-Württemberg.
Mit Blick auf den Pkw-Bestand ist der Anteil von BEV in der Hansestadt Hamburg (4,8 Prozent) und dem Land Hessen (4,3 Prozent) am höchsten, während sich Baden-Württemberg und Bayern mit 4,2 bzw. 4,1 Prozent knapp dahinter befinden. Die niedrigsten Werte weisen auch hier Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 1,7 Prozent sowie Sachsen und Thüringen mit jeweils 1,9 Prozent BEV am gesamten Pkw-Bestand auf.
Entwicklung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur: Vor allem die Zahl der Schnellladestationen hat zugenommen
Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland hat im Jahr 2024 weiter zugenommen (siehe Abbildung 6). Insgesamt ist die Ladeleistung in Deutschland von 4.577.077 kW zum Ende des Jahres 2023 auf 6.159.819 kW im Dezember 2024 angestiegen (+35 Prozent). Während die Wachstumsraten des Vorjahres zwar nicht wieder erreicht werden konnten – im Jahr 2023 wuchs die verfügbaren Ladepunkte um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr – ist insbesondere die Anzahl der Schnellladepunkte stark angestiegen (+39 Prozent). Waren es zum Ende des Jahres 2023 noch 24.095 öffentlich zugängliche Schnellladepunkte, also Ladepunkte an denen Strom nach Angaben der Bundesnetzagentur mit einer Ladeleistung von mehr als 22 kW geladen werden kann, stieg die Zahl bis zum 01.12.2024 auf 33.419 Schnellladepunkte. Bei den Normalladepunkten, also den Ladepunkten mit höchstens 22 kW Leistung, stieg der Anteil um 19 Prozent von 101.638 auf 120.618 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Damit ist mehr als jeder vierte der insgesamt 154.037 öffentlich zugänglichen Ladepunkte ein Schnellladepunkt (22 Prozent).

Im Hinblick auf die Ladeleistung verzeichnete insbesondere die Zahl der Ladepunkte mit einer Leistung von über 59 kW einen deutlichen Anstieg (+40 Prozent). Dennoch sind in Deutschland nach wie vor öffentliche Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 22 kW (Normalladepunkte) am weitesten verbreitet.
Demnach schreitet der Zubau der Ladeinfrastruktur, entgegen dem Trend bei den BEV-Neuzulassungen, konstant voran. Dies ist von besonderer Bedeutung, da das Vorhandensein einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ein entscheidendes Argument gegen die sogenannte „Reichweitenangst“ darstellt, die häufig als Hürde für den Kauf eines batterieelektrischen Fahrzeugs geäußert wird.
In Bezug auf die Dichte der öffentlichen Ladeinfrastruktur pro Quadratkilometer ist die Ladesäulendichte der Schnell- und Normalladepunkte in Berlin, Hamburg und Bremen am höchsten (siehe Abbildung 7). Danach folgen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Gemessen an der Einwohnerzahl liegen jedoch Bayern (2,3 Ladesäulen pro 1.000 Einwohner), Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein (jeweils 2 Ladesäulen pro 1.000 Einwohner) vorne. Es lässt sich feststellen, dass die Unterschiede in der Ladesäulendichte zwischen den Bundesländern, gemessen an der Einwohnerzahl, deutlich weniger signifikant sind als bei der Betrachtung der Fläche (Ladesäulen pro km²).
Den größten Zuwachs an öffentlichen Ladeeinrichtungen hatten im letzten Jahr die Hansestadt Bremen (+41 Prozent), Hessen (+32 Prozent) sowie Berlin (+29 Prozent) zu verzeichnen. Auch in allen anderen Bundesländern wuchs die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte. Den geringsten Zubau gab es im Saarland (+14 Prozent), in Schleswig-Holstein (+16 Prozent) und in Baden-Württemberg (+17 Prozent).

Durchschnittliche CO2-Emissionen neuer Pkw in Deutschland steigen und verfehlen EU-Vorgaben
Die im Jahr 2024 neu zugelassenen Pkw emittierten im Mittel 119,8 g CO2/km. Dies entspricht einem Anstieg von insgesamt 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (siehe Abbildung 8). Die durchschnittlichen CO2-Emissionen lagen damit über dem im Jahr 2024 geltenden EU-weiten Flottengrenzwert von 115,1 g CO2/km (nach WLTP-Messverfahren). Ab dem Jahr 2025 gelten noch einmal schärfere EU-Grenzwerte von durchschnittlich 93,6 g CO2/km sowie strengere Flottengrenzwerte für die einzelnen Automobilhersteller.

Um die Flottengrenzwerte einzuhalten, ist es für die Autohersteller daher erforderlich, den Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) sowie von besonders emissionsarmen Verbrennern deutlich zu steigern, ansonsten drohen ihnen Strafzahlungen. Dies ist angesichts der Tatsache, dass die CO2-Emissionen im Jahr 2024 bereits das zweite Mal in Folge wieder angestiegen sind und die festgelegten Zielwerte überschritten haben, keine einfache Aufgabe. Dabei sind die Herausforderungen für die einzelnen Hersteller aufgrund der herstellerspezifischen Flottengrenzwerte unterschiedlich groß.
Übrigens:
Das Pkw-Label informiert darüber, wie klimafreundlich und kostengünstig ein Neuwagen im Betrieb ist. Es enthält Angaben über den spezifischen Energieverbrauch und die damit verbundenen CO₂-Emissionen.
Ausblick
Trotz des langsameren Zuwachses der Neuzulassungen von Elektroautos setzt sich der Ausbau der E-Mobilität in Deutschland weiter fort. Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte wächst in allen Bundesländern deutlich und auch die Gesamtzahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge steigt. Allerdings verlief der Zuwachs an neuen E-Autos, insbesondere vollelektrischen Pkw, im Jahr 2024 deutlich langsamer als in den Vorjahren.
Würde sich der Marktanteil der BEV in dem Tempo der letzten Jahre weiterentwickeln, würde das Ziel der Bundesregierung von 15 Millionen vollelektrischen Pkw bis 2030 deutlich verfehlt werden. Gemessen an den Zulassungszahlen der letzten Jahre würden stattdessen nur rund vier bis fünf Millionen BEV auf den Straßen unterwegs sein und die Erreichung der CO2-Minderungsziele im Verkehrssektor wäre weiterhin gefährdet. Obwohl die Zahl kraftstoffsparender Hybridfahrzeuge im Jahr 2024 deutlich gestiegen ist, können signifikante CO2-Emissionsminderungen vor allem durch einen zunehmenden Anteil von BEV am Pkw-Bestand in Deutschland erzielt werden.
Das Aus zentraler Förderinstrumente wie des Umweltbonus, die allgemeine wirtschaftliche Krisenstimmung sowie Schwankungen der Kraftstoff- und Strompreise dürften im Jahr 2024 zur Zurückhaltung gewerblicher und privater Kundinnen und Kunden beim Kauf neuer Elektrofahrzeuge beigetragen haben. Auch das nach wie vor begrenzte Angebot an preisgünstigen BEV-Modellen sowie anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich der Reichweiten und der Verfügbarkeit öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur – trotz der nachgewiesenen Fortschritte im Ausbau – könnten weiterhin eine Quelle der Verunsicherung für viele Nutzergruppen darstellen.
Steuerliche Anreize machen es für Unternehmen interessant, auf elektrische Dienstwagen zu setzen, wobei PHEV derzeit im Vorteil sind, von steuerlichen Vergünstigungen zu profitieren und zugleich die Flexibilität von Verbrennungsmotoren zu erhalten. In Zukunft wird es darum gehen, die tatsächliche CO2-Minderungswirkung der Fahrzeuge zu steigern, indem betriebliches Lademanagement ausgeweitet und steuerliche Vergünstigungen von vollelektrischen Pkw herausgestellt werden.
Vielversprechend klingen die Ankündigungen einiger Hersteller, im Jahr 2025 preisgünstigere BEV-Modelle auf den Markt bringen zu wollen. Zuversichtlich stimmen auch zahlreiche Nachrichten über Innovationen und weitere technische Fortschritte bei der Batterieentwicklung. Darüber hinaus wird die Verschärfung der EU-Flottengrenzwerte ab 2025 die Autohersteller zunehmend unter Druck setzen, ihre Bemühungen um den Absatz CO2-armer Fahrzeuge zu intensivieren, um Strafzahlungen zu vermeiden.
Um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, muss der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland weiter beschleunigt werden. Entscheidend dafür ist, der Elektromobilität einen verlässlichen politischen Rahmen zu bieten. Dies umfasst unter anderem das Festhalten an den vereinbarten CO2-Flottengrenzwerten der EU, die Schaffung zusätzlicher Anreize für die Nutzung batterieelektrischer Fahrzeuge und die klare Kommunikation der Vorteile dieser Antriebstechnologie. Darüber hinaus muss das Tempo beim Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur der letzten Jahre beibehalten werden. Gleichzeitig gilt es, Lösungen für einen schnelleren Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur, insbesondere in Quartieren mit Mehrfamilienhäusern, zu finden.
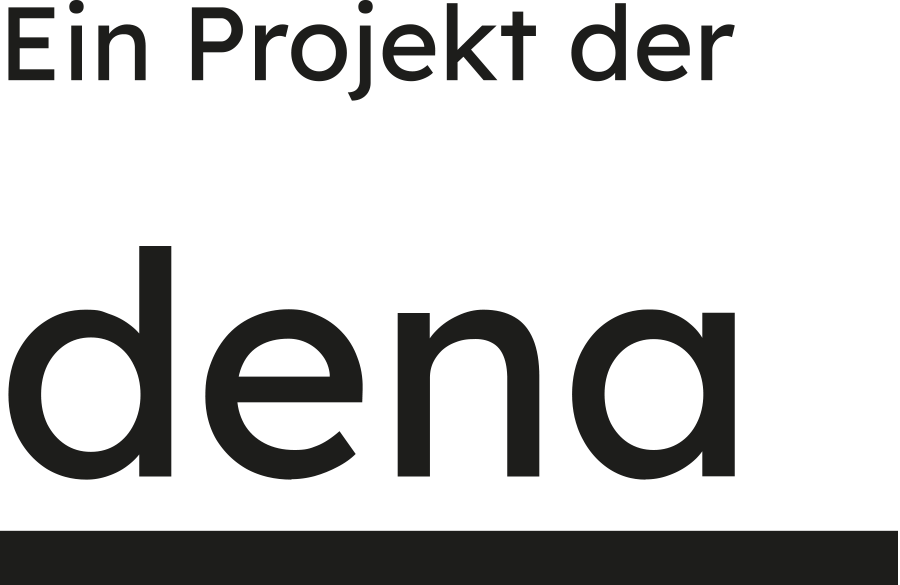
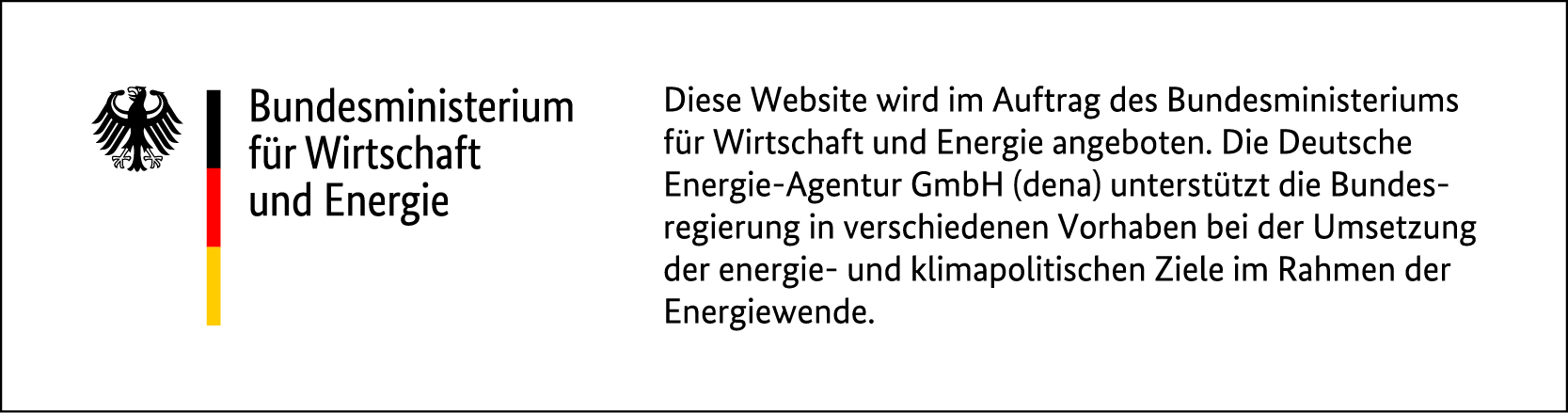
Rechtlicher Hinweis
Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) informiert im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dieser Informationsplattform zur Verkehrs- und Mobilitätswende. Darüber hinaus erhalten Hersteller und Händler Informationen zur Umsetzung der novellierten Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Dabei handelt es sich um allgemeine Hinweise, die nicht rechtsverbindlich sind. Für konkrete Fragen ist ggf. eine Rechtsberatung einzuholen. Die dena übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der mittels des Online-Tools zur Erstellung eines Pkw-Labels berechneten Ergebnisse. Entscheidend sind u. a. die Herstellerangaben.